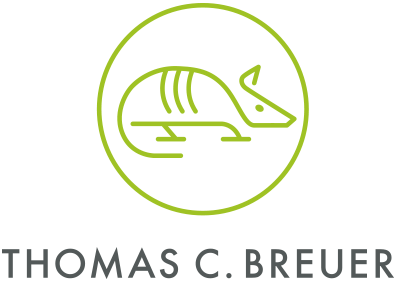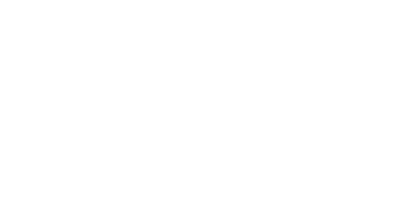Cover of the Rolling Stone
Zeitpunkt: einzige – Konzerte, im Haus der Jugend in Freiburg. (Of all places …)
Natürlich habe ich mir gedacht, das sei doch eine tolle Geschichte für den Rolling Stone. Falsch gedacht.
Cover of the Rolling Stone
„Well, we’re big rock singers, we got golden fingers“ – „große Rocksänger“: in unseren Ohren waren sie das, sogar mit einem veritablen Hit – „Sylvia’s Mother“, No. 5 in den USA, Nr. 9 in Deutschland – die Geschichte einer nervigen Mutter, die einem Taugenichts den Zugang zu ihrer Tochter verweigern will. Zwischendrin schaltet sich immer wieder der Operator dazwischen, der Vermittler, der aber gar nicht vermitteln will, sondern im Auftrag der Telefongesellschaft horrendes Geld einfordert.
Was in aller Welt hatten Dr. Hook & The Medicine Show also in Freiburg verloren? Noch dazu im Haus der Jugend, also diese Art von Location, die auch uns geläufig war – Dr. Hook & The Medicine Show waren zu diesem Zeitpunkt – im März 1974 – das medizinische Team unseres Vertrauens, ein paar der launigen Songs hatten wir mit unserer Band Quetschwaltz sogar ins Repertoire genommen: Ironie war ihre Kernkompetenz, und damit halfen sie uns über manche dunkle Stunde im engen Koblenz hinweg. Den Rest erledigten die Substanzen. Sie hatten uns gleich am Haken, und genau deswegen hatten wir uns damals von Koblenz auf den Weg nach Freiburg gemacht, mit einem Deuxchevaux, was natürlich verdammt nach Klischee klingt, aber den Tatsachen entspricht, vom Mittelrhein vierhundert Kilometer mit maximal 100 km/h hinunter nach Südbaden, zum wohl einzigen Konzert der Band in Deutschland.
In ihren besten Tagen sind Dr. Hook & Co. gelegentlich in Glitzerkostümen als ihre eigene Vorgruppe aufgetreten, Slade für Arme, bis das Publikum anfing, unangenehm zu werden und es ratsam erschien, sich zu erkennen zu geben. Als wir im HdJ ankamen, schrubbte gerade eine uninspirierte Combo ihr Repertoire runter, dermaßen erbärmlich, dass wir uns in die Ellenbogen in die Seite stießen und uns zunickten: Sie tun es wieder, diesmal als Hardrocker verkleidet. Wir warteten auf die Auflösung, oder besser Erlösung, und waren bitter enttäuscht, als ein uns unbekannter Ansager die Gruppe vorstellte. Die Jungs kamen aus Hannover, wohin sie unserer Meinung schleunigst zurückkehren sollten, und nannten sich: Scorpions.
Unserer Band war wenig heilig. Koblenz ist eine streng katholische Stadt, da bedurfte es keines großen Aufwands, um Bürger zu provozieren, auch die vermeintlich weniger Bürgerlichen auf der Linken waren leicht entflammbar. Wir hatten es immerhin geschafft, bei einer Wahlveranstaltung der DKP als Vorgruppe von Lok Kreuzberg (den späteren Spliff) die Rhein-Mosel-Halle in einen Gefrierschrank zu verwandeln, als wir ein Biermann-Lied mit einer DDR-Hymne über das sowjetische Ehrenmal am Treptower Park koppelten: „Soldat, Soldat im schönen Park, dein Blut ist bloß Tomatenmark!“ Biermann und die moskauhörige DKP – absolutes No-Go. Verunglimpfung der Sowjetunion? Todsünde. Viel mehr haben wir leider nicht erreicht. Hook-Songs wie „Everybody’s Making It Big But Me“ und „The Cover of the Rolling Stone“ fielen bei uns auf fruchtbaren Boden, aber aufs Cover irgendeiner Zeitung schafften wir es nie, wir hätten schon eine gründen müssen. Damals war Ironie in Deutschland sozusagen verschreibungspflichtig, erst allmählich schickten sich Interpreten wie Ulrich Roski, Insterburg und Co. oder Schobert & Black an, die Deutschen mit diesem Genre bekannt zu machen, allerdings nicht unbedingt nachhaltig.
Alle haben damals geglaubt, Ray Sawyer sei der Bandleader. 1967 hatte er bei einem Autounfall in Oregon nur knapp überlebt – sein rechtes Auge jedoch nicht. Womöglich hätte er sich ein Glasauge leisten können, zumindest später, aber vielleicht stand ihm Moshe Dayan Pate, der fünf Jahre zuvor ein Medienstar gewesen war, wenn auch aus anderen Gründen. Hook bedeutet natürlich Haken, also auch einen zum Entern. Die Augenklappe galt als typisches Accessoire von Piraten, allerdings erst, seit sie im 19. Jahrhundert in Karikaturen aufgetaucht war. Drei Mitglieder der Band waren den Südstaaten entkommen, Ziel New York City, blieben aber in Union City, New Jersey, hängen, wegen der schönen Lichter: Sie glaubten schlicht, sie befänden sich schon im Big Apple. Streng übersetzt bedeutet Union City auf deutsch „Gewerkschaftsstadt“. Wer freiwillig in „Nu Juicy“ bleibt, muss schon einen kruden Sinn für Humor haben. Vor einigen Jahren erzählte der Songwriter John Gorka bei einem Konzert in Santa Cruz, er stamme ursprünglich aus New Jersey, woraufhin wie aus der Pistole geschossen jemand aus dem Publikum rief: „Which exit?“ In der Tat haben wir es mit einem Staat zu tun, deren Ansiedlungen sich um eine endlose Reihe von Autobahnabfahrten gruppiert haben, eher humorfreies Terrain, wenn wir an die Gemetzel der Soprano-Familie denken. Bruce Springsteen, Bon Jovi oder Frank Sinatra sind auch nicht mit Ironie in Erscheinung getreten.
Wie der Bandname entstanden ist? Gitarrist George Cummins behauptet, er sei darauf gekommen, als der Besitzer des Bandbox Club in Union City nach einem Namen für das bislang namenlose Ensemble verlangte, und Cummins spontan Sawyers Augenklappe einfiel und dann Captain Hook in J.M. Barries „Peter Pan“. Als nächstes dachte er an Drogen und somit irgendwie an Medizin. Echte Medicine Shows waren vor allem in der Mitte des 19. Jahrhunderts unterwegs gewesen, bevorzugt in den ländlichen Gebieten des amerikanischen Südens, aber auch in Deutschland hatte es einen Doktor Eisenbarth gegeben. Kleinunternehmer, die den Leuten Schlangenöle oder andere Elixiere andrehten, eher lächerliche Produkte wie z.B. Hadacol, das angeblich nicht nur medizinische Probleme beseitigte, sondern auch Falten, Flecken oder Moskitos, eine lebensverlängernde universelle Wagenschmiere, oder, wie es der Bluesmusiker Roy Book Binder auf den Punkt gebracht hat: „Es war der Vorwand, den Kirchenmuttis Alkohol zu verkaufen.“
Mit Dr. Hook & The Medicine Show hatte alsbald ein gewisser Shel Silverstein sein optimales Sprachrohr gefunden, denn er selbst verfügte laut Country-Papst Chet Atkins über „die womöglich schlechteste Stimme aller lebenden Menschen“. Shel war das Mastermind hinter der Band, ein ehrfurchteinflößender, kahlköpfiger Mann mit einem Rauschebart wie ein Hipster-Prototyp, den wir schon deshalb verehrten, weil er längere Zeit in Hugh Hefners Playboy-Anwesen in Los Angeles residiert hatte, ohne dass wir genau wissen konnten, welche Möglichkeiten sich einem da überhaupt boten. Er nutzte die seinen als Cartoonist des Playboys. Es existieren Aufnahmen von ihm, wie er im Bademantel konzertiert, umringt von rauchenden Bunnys und anerkannten Wüstlingen wie Bill Cosby. Silverstein belieferte das Magazin regelmäßig mit seinen skurrilen Zeichnungen, Geschichten und Gedichten, zu einer Zeit, als es den Playboy häufig nur unter dem Ladentisch gab. Unerklärlicherweise fanden ab und an Exemplare zu uns, deren Besitz wir mit dem geflügelten Wort erklärten: „Tolle Kurzgeschichten!“ Silverstein selbst beantwortete die Frage, was er im Leben erreichen wollte, mit „Spaß haben“. Später hing er oft in Nashville ab, mit Outlaws wie Willie, Waylon und Kris. Leisten konnte er sich das, denn wenn ihm etwas leichtfiel, waren das: Hits. Auch jüngere Generationen kennen vermutlich mehr Silverstein-Songs, als sie ahnen. Für die Irish Rovers schrieb er „The Unicorn“, die Irish-Pub-Nationalhymne. Die Rovers kamen nebenbei aus Kanada. „The Ballad of Lucy Jordan“ verhalf Marianne Faithfull zu einer zweiten Karriere, und für Johnny Cash schrieb er ein Evergreen, das dieser erst zwei Tage vor dem legendären St. Quentin-Konzert einstudierte und auf Anraten seiner Frau June ins Repertoire aufnahm: „A Boy Named Sue“. Cash nannte ihn später den am „cleversten geschriebenen Song, den er je gehört habe“.
Auf Youtube kann man einen Auftritt der Medicine Show in Dänemark bestaunen, aus demselben Jahr wie das Freiburger Konzert, also 1974, und so habe ich sie in Erinnerung: Die Jungs bekifft bis zur Halskrause, die Augenlider auf Halbmast, der THC-Gehalt im Blut setzt sicher neue Standards. Wenn solche Bands auf Europatournee eine Landesgrenze passieren müssen, lief den Zollbeamten schon das Wasser im Munde zusammen: Sie erhofften sich Drogenfunde, die ihre Beförderung beschleunigen würden, wenn sie diese Burschen erst einmal auseinandergenommen hatten. Dabei spielten die Hooks das dänische Konzert mit erstaunlicher Präzision, keine scheppen Harmonien, stellenweise virtuos an den Instrumenten, und selbst das Herumfallen und -torkeln gehorchte einer atemberaubenden Choreografie. Die Frage, ob sie auf der Bühne tatsächlich immer bekifft gewesen wären, beantwortete Dennis Locorriere einmal so: „Natürlich. Und David Bowie war tatsächlich vom Mars.“ Dennoch war die Kifferlache, die vielleicht lediglich ihre Interpretation von Lachyoga darstellte, so etwas wie der „unique selling point“ der Band.
Am 29. März 1973 – vor fünfzig Jahren also – war es dann tatsächlich so weit, sozusagen eine „self-fulfilling prophecy“: Mit der etwas genervt erscheinenden Zeile „What’s-their-names make the Cover“ erschien in Ausgabe 131 des Rolling Stone zumindest eine Karikatur dreier Bandmitglieder der Band von Gerry Gersten auf dem Titelblatt. Damit befand sich in bester Gesellschaft: Nummer 130 hatte Robert Mitchum präsentiert und das Titelbild 132 würde Truman Capote zieren. Das war der März 1973: Pink Floyd veröffentlichten ihr Album „Dark Side of the Moon“, Watergate steuerte seinem Höhepunkt entgegen, Luboš Kohoutek entdeckte einen neuen Kometen, in London wurde erstmals eine Frau an der Börse zugelassen, Salvador Allende gewann die Wahl in Chile, was ihm letztlich leider nicht weiterhalf, und Ende des Monats verließ der letzte amerikanische Soldat Vietnam. Die O’Jays toppten mit „Love Train“ die amerikanischen Charts. Die Nummer 6 der Billboard-Charts am 17. März: „Cover of the Rolling Stone.“ Die BBC weigerte sich allerdings, den Song zu spielen – wegen Produktplatzierung.
Den Text von „Cover“ hatte ihnen ihr Hausdichter Silverstein telefonisch von seinem Hausboot in Sausalito durchgegeben, komponiert wurde kurzerhand im Bandbus, und der Song selbigen abends auf die Bühne gestellt und sechs Monate in Folge gespielt, bevor sie ihn Ende 1972 in San Francisco für ihr Album „Sloppy Seconds“ aufnahmen, in der passenden Stadt also, die wegen ihrer Offenheit gewissen Substanzen gegenüber einen legendären Ruf genoss. Betriebsmotto der Band: „I got stoned and I missed it“. Zunächst sah es nicht so aus, als würde sie dieser Song tatsächlich aufs Titelbild des Rolling Stone hieven. Nicht mal ein Frei-Abo rückten man dort raus. Andererseits, so Dennis Locorriere, einer der Sänger der Band, aber nicht der mit der Augenklappe, hatte der Song dem Magazin so viel Aufmerksamkeit und somit neue Abonnenten beschert, dass es in der Jahresendausgabe zumindest zu eine ehrenvollen Erwähnung reichte mit einem Foto von Ray Sawyer – richtig, dem mit der Augenklappe: „Danke für den Song!“ Damals war der Begriff „win-win-situation“ noch nicht einmal in Umlauf. Apropos: Das Interview zur Covergeschichte drei Monate später führte ein gewisser Cameron Crowe, zu dem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt. Der schrieb selbst Rockgeschichte mit seinem Film „Almost Famous“, und im dazugehörigen Soundtrack fand sich – Überraschung! – „Cover of the Rolling Stone“.
1975 schickten Dr. Hook den Beinamen „Medicine Show“ in die Wüste, das hatten Chicago schon fünf Jahre vorher mit der „Transit Authority“ gemacht, angeblich, weil die gleichnamigen Verkehrsbetriebe der „Windy City“ ordentlich Wind gemacht hatten, eher aber weil sie den kommerziellen Erfolg suchten, und dem stand ein komplizierter Name im Wege. Dr. Hook musste wenig später trotz vieler Hits Bankrott anmelden. In unseren Augen war das völlig in Ordnung, denn hätten sie ihre Tantiemen in Aktien angelegt, wären wir misstrauisch geworden. Dennis Locorriere kommentierte das so: Immer, wenn sie eine Tour mit schwarzen Zahlen abgeschlossen hatten, feierten sie in die roten hinein. Ihre erste Platte nach dem finanziellen Desaster hieß folgerichtig „Bankrupt“, plötzlich spielten sie diskotaugliche, aber schuldentilgende Stromliniensongs, die „Augenklappe“ Ray Sawyer übrigens entsetzlich fand. Locorriere schwört, dass er erst die volle Aufmerksamkeit von Programmdirektoren bekam, nachdem er sich einen gesellschaftlich akzeptablen Haarschnitt hatte verpassen lassen – fürs Radio!
Seit dem 1. Januar 2021 ist in New Jersey der Konsum von Cannabis zum Freizeitgebrauch straffrei. Wenn Ray Sawyer, der Sänger von „Cover“, das noch hätte erleben dürfen. Leider ist er an Silvester 2018 im abgasgeschwängerten Daytona Beach gestorben. Dennis Locorriere lebt in Nashville als Songschreiber – er war als erster aus der Band ausgestiegen: „Nach fünf Abenden auf der Bühne wollte ich nichts anderes als mich hinsetzen und ein Buch lesen.“ Über ihr damaliges Repertoire sagte er wesentlich später: „Es gibt viele Songs von Shel, die ich heute besser verstehe als damals.“ Mir geht das ehrlich gesagt schon mein ganzes Leben lang so, und nicht nur bei den Songs von Shel Silverstein, die heutzutage sicher mit der Warnung „Contains strong language!“ versehen wären. Eines haben sie uns beigebracht: Dass eine ironische Distanz nicht die schlechteste Lebenseinstellung ist, sondern eher eine lebensverlängernde Maßnahme, und somit eine Art Medizin.
Unsere Band löste sich zwei Jahre später auf, und anders als die Medicine Show haben wir keinerlei Anstrengungen unternommen, uns wiederzuvereinen. Mit der Ironie ist das übrigens immer noch so eine Sache: Wenn die Leute wirklich einen Sinn dafür hätten, wieso sind dann so viele Smileys in Umlauf?
© Thomas C. Breuer Rottweil 04.11.2022