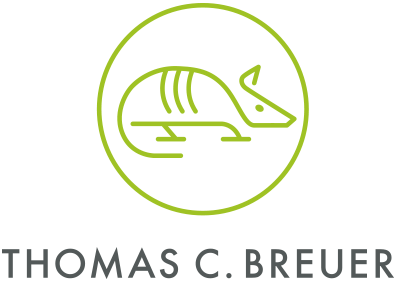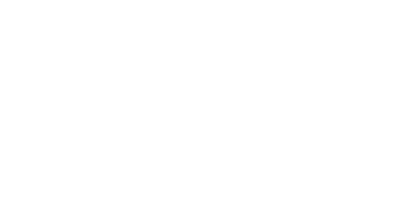Balkan 2018 – ein Grenzerfahric-Trip

Eigentlich recht angenehm zu reisen, wenn man von den Fesseln des Reisejournalismus befreit ist, also keinen Auftraggeber und ergo keinen Termindruck hat. Dennoch höchste Zeit, den Geltungsbereich der Deutschen Bahn zu verlassen, heute treiben sie es wieder auf die Spitze mit ihrer Trödelei aus Inkompetenz. 45 Minuten plus hat der Anschluss in Stuttgart, ich weiche aus auf Regionalbahn und IC, muss die SZ selbst kaufen (im ICE gäbe es sie gratis) und der notwendige Proviantstopp in München mit Geldwechsel und Buchhandlung ist gestrichen. So wie Amazonasforscher sich Fluss und Natur anpassen müssen, so gibt dem Schienenflaneur die Bahn den Takt vor.
Das Fremde, Urwüchsige, fast Wilde fasziniert mich an Ungarn, aber so richtig sympathisch ist es mir nicht mehr, im Gegenteil. Jetzt, wo es auf die Grenze zugeht, warnen sie vor Taschendieben – vorher nicht. Aber das ist nicht das Problem. Gut, im Gegensatz zu früheren Besuchen kann ich einfach so über die Grenze rauschen, niemand fragt nach den Papieren, keiner stempelt, aber der MÀV-Schaffner wird von einem glatzköpfigen Securitykiller begleitet, der aussieht wie Orbáns Kettenhund.
Budapest Keleti pályaudvar, der Ostbahnhof. Sie servieren Heineken, die kennen keine Scham. Das einzige Restaurant um den Bahnhof Keleti, das den Namen verdient hat, ist im Bahnhof selbst, alles ein wenig pompös, überdosiert, kirchenschiffartig, dabei runtergerockt. Patina trifft es nicht, es liegt ein paar Etagen drunter. Den ganzen Glanz hat eh der Westbahnhof – Nyugati – abbekommen, weil da die Hochwohlgeborenen aus Wien eintrafen, die im bahnhofseigenen Palmengarten promenieren oder im Königlich-Kaiserlichen Wartesaal der Dinge harren konnten. Bei der grosszügigen Bahnhofshalle hat Gustave Eiffel mit schwungvollen Stahlkonstruktionen für den Eiffelturm geübt. Für den Osten war wie immer kein Geld mehr übrig, Im Restaurant spielt das völlig überdrehte Hungarenradio Supertramp. Ein Oldiesender, der sich auf eine Zeit bezieht, die die Ungarn so sicher nicht erlebt haben: Zu Sex, Drugs und Rock’n’Roll kam es in der Puszta eher selten. Gut, so genau weiß ich es eigentlich nicht, immerhin haben sie sich fortgepflanzt in all den Jahren. Trotzdem: Nachholradio. Sonst hat sich die alte Bude kaum verändert, es fehlen moderne Zutaten wie Press & Books, Sushiwrap, Dean & David oder Burger King. Vierzig Jahre ist das her mit der letzten Visite. Damals war ich folglich 26, absolut unbeleckt von allem, und musste mit meinem Freund Klaus im Bahnhof übernachten, denn nach einem Brand im Hotel Duna Irgendwas hatte man die Gäste kurzerhand auf alle verfügbaren anderen Hotels umquartiert.
Erster Mai 2018, 6:40 am Morgen, mein erster Zug der Căile Ferate Române, mit Steckdosen fürs Laptop. Und so angeranzt, wie man sich das kleingeistig vorgestellt hat. Beim vorgegebenen Tempo lernt man recht schnell bzw. eben langsam, warum der Zug fünfeinhalb Stunden bis Timișoara braucht, das Auto aber nur drei. Die extrem heruntergedimmte Geschwindigkeit auf der Brücke über den Korös gibt zu denken, vor allem, was deren Stabilität anbelangt. Jetzt halten wir in Gyoma, was mir lieber ist als Goma, und da kommen sie doch noch, die Magyaren, mit ihren Stempelkissen wie damals unter Kádár – der Unterschied: Die Stempel kommen nur bei Nichteuropäern zum Einsatz. Der Waggon ist mit Videobildschirmen ausgestattet, zum Glück ist die Anlage kaputt, ebenso wie die fürs Klima. Wir halten in Csardaszallas, Mezöbereny, Bekescsaba, Ketegyhaza, das klingt einfach! Den vierzigminütigen Aufenthalt in Lököshaza muss mir mal einer plausibel erklären, die Abfertigung von zwei Waggons und das Abkoppeln weiterer kann doch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, und gleich jenseits der Grenze, in Rumänien, wo es auch nicht anders aussieht, kommen noch einmal dreißig Minuten hinzu. Das soll Europa sein?

Auf der rumänischen Seite spendieren sie uns immerhin eine Runde Licht. Aber kein Klima. Für Freunde des gehobenen Verfalls ist dieses Land auf den ersten Metern ein Eldorado. Was die Rumänen anscheinend nicht mögen: Ihre Häuser zu verputzen. Aber dann der Bahnhof von Curtici: Wie geschleckt. Die Schaffner tragen Hemden, die an Friseurkittel erinnern.
Was die Rumänen anscheinend mögen: In der Innenstadt zu rasen. Auch diese Stadt ist sauber, im öffentlichen Raum. Die Müllecken finden sich im privaten. Timișoara, so wird behauptet, sei der Gegenentwurf zu anderen rumänischen Städten, bunt, gepflegt, mit Wirtschaftswachstum. Das erklärt die Starbucksfiliale, gleich im Hotelgebäude. Ein Muss, ich trinke einen Cappuccinul. Dieselbe Klientel wie überall, aber wie können die sich das hier leisten? Überwiegend sind es die jungen Frauen, die zielstrebig reinschneien, mit eher verlegenen Burschen im Schlepptau. Das vegetarische Restaurant der Stadt, in dem ich wenig später esse, hat eine exzellente Besprechung erfahren in einem Magazin, das Happy Cow heißt.
Die Taubendichte auf der Piața Victoriei kann lässig mit dem Markusplatz mithalten. Bin jetzt 1.311 Kilometer von zuhause. Hier in Timi haben sie eine erfrischend andere Herangehensweise an Hygiene, und Holsten halten sie für ein Bier, man kriegt es überall, dennoch ein gelungener Ort. 2021 wird man Kulturhauptstadt, ein würdiger Rahmen, man hätte keinen besseren Schauplatz finden können. Kultur tropft hier aus jeder Pore, sogar ein deutsches Theater gibt es. Ein inspiratives Klima, ich songtexte wie ein Berserker, die Stadt setzt einen Kreativschub in Gang, das Havanna des Banats. Die Pflastermaler sind schon hier, die Ballonaufbläser, die Straßenmusiker. Nebendran sitzt einer in einem NASA-Anzug mit einer Art Taucherglocke auf dem Schädel in der sengenden Sonne, das ist anscheinend schon ausreichend Kunst, weiter tut er nichts, und der Kerl nebenan lässt seinen Papagei anschaffen, den er als Fotomotiv verhökert. Eine reinhauen sollte man ihm, aber passend dazu fällt mir ein, dass sie in anderen Teilen dieses Landes Bären gegeneinander kämpfen lassen.

Auffällig, dass die Frauen nicht nur im Starbucks sehr viel eleganter und selbstbewusster daherkommen als die Männer, die nicht zuletzt wegen ihrer kurzen Hosen eher bubihaft wirken, und die dämlichen T-Shirt-Sprüche reißen es ebenso wenig raus: „Sorry, nothing great today!“, auch wenn es zutreffen mag. „Hammer Times!“ ziert den Bettler, der wohl bald sein linkes Bein verlieren wird, das er bereitwillig zur Schau stellt.
Bei einer Straßenbahn ist der Zielort aus der Anzeige gerutscht, jetzt sieht man: „Werkstattwagen“. Des Rätsels Lösung: Die hiesigen Exemplare haben ihren Dienst früher in Karlsruhe versehen, also haben sich die Waggons eindeutig verbessert. Auch bei den Straßenbahnen verzichtet man auf Klimaanlagen, weshalb die Menschen sicher weniger erkältet sind als anderswo. Ständig sind Sirenen zu hören. Ein Novum: Auf dem Parkplatz vor dem Hotel ein nigel-nagel-neuer Bus aus Albanien, mit Schulkindern, die interessierte Blicke auf meine orangefarbenen Sneakers werfen. Im Verlauf der Reise sollen mir immer wieder Busse aus Tirana begegnen, wahrscheinlich sind die Unternehmer derzeit im Preisdumping ganz vorne dran. Der in Belgrad hatte vorne ein Schild: „Dr. Tigges Reisen“, und das ist ja beim besten Willen kein altes albanisches Geschlecht. Irgendwann werden wir uns auch an moldawische Transporter gewöhnen.
Von Timișoara nehme ich nur ungern Abschied, wobei der Nordbahnhof das Prozedere eher leichter macht, als hätte Ceaucescu ihn persönlich zu verantworten, vielleicht hat er das auch, dazu viel Elend und Verwahrlosung, aber immerhin von einer gewissen Gelassenheit, vom Bahnhofsgebäude ein ebenerdiger Zugang zu den Gleisen, keine Absperrung, keine Uniformen. Durchfahrende Züge geben rechtzeitig Signal, Menschen bleiben stehen, fertig. Der Zug nach Budapest ist eine Dreiviertelstunde vor der Abfahrt zugänglich, Punkt. Die Tafel mit den Reservierungen ist mit Tesafilm an die Abteiltür geklebt. Die Abfahrt: Pünktlich.
Das alte Spiel: Dreißig Minuten plus Rumänien, vierzig in Ungarn. Die Rumänen schreiben die Daten wahrhaftig in einen Block und sprechen einen unvermittelt mit Vornamen an, um zu sehen, ob man reagiert. – analoge Überprüfung. Der Zug ist längst abgefertigt, die Polizei durch, die zusätzlichen Waggons hinten und die Magyarenlok vorne drangeklemmt, wieso also warten wir hier, zwischen zwei Ländern der Europäischen Union? Unnötige siebzig Minuten auf den Fahrplan draufgepackt, bei einer internationalen Verbindung. Die Rumänen übrigens sind am hellichten Tag mit Stablampen und kleinen, wackeligen Trittleitern durchs Abteil geschrubbt, vielleicht, um besser an die Deckenverkleidung heranzukommen. Da sind die Leitern der Ungarn schon von anderer Qualität. Als nächstes hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage, warum es den Bahnverantwortlichen nicht gelingt, an den Morgenzug von Budapest nach Temeswar einen Erstklasswagen zu hängen, an den in umgekehrter Richtung aber schon. Fällt das eigentlich den europäischen Eisenbahnplanern in Brüssel oder sonst wo nicht auf, diesen Typen, die nur in Transversalen und Korridoren denken, dass hier dringender Bedarf im Kleinen herrscht? Wie kann man sich über Eitelkeiten und Empfindlichkeiten der Grenzbewahrer hinwegsetzen? Ganz einfach: „Entweder ihr streicht die unnötigen Aufenthalte auf ein Minimum zusammen oder wir streichen euch das Geld.“ Wie will man so dem Luftverkehr die Stirn bieten? Könnten bei der Gelegenheit die Verantwortlichen ihrem Kontrollpersonal verbindlich verklickern, dass sie sozusagen das Begrüssungskomitee darstellen, also die Visitenkarte eines Landes abgeben, und sich entsprechend freundlich zu verhalten haben? Zwischen Slowenien und Kroatien ist es nicht besser. Vielleicht dienen die ausgedehnten Aufenthaltszeiten lediglich dazu, Verspätungen abzupuffern.
Schon bei der Einreise vor ein paar Tagen hatte ich große Mühe, den Ungarn ihre derzeitige politische Ausrichtung nachzusehen. Bei jedem zweiten Bahnsteiggesicht denke ich: Und? Fidesz? Jobbik? Schließlich hat der grässliche Orbán eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Kann es sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der politischen Deformierung und der Vielzahl der Einfamilienhäuser auf dem platten Land? Das sind alles Besitzstandswahrer, und wie entscheiden die sich wohl? Dabei ziert jede zweite Brücke, die wir queren, eine Riesentafel, die die EU als Hauptfinanzierer auslobt. Köszönöm, EU. Das haben die Ungarn gar nicht verdient. Wahrscheinlich wegen der magyarischen Rosinenpickerei in EU-Belangen mag ich mich nicht wohlfühlen hier, obwohl das Budapester Elisabethenviertel eine gewisse Versatilität ausstrahlt. Hier kann man Hipster in freier Wildbahn beobachten. Ich beziehe meine Gedanken zu einem Land selten aus Museen und schon gar nicht aus Kirchen, ich laufe durch die Straßen und versuche einfach, Augen und Ohren offen zu halten.

Der D-Zug 343 verlässt die EU, und ist demzufolge eine echte Klapperkiste, ein respektabel versiffter Waggon serbischer Herkunft. Die Lokomotive ist eher betagt zu nennen, und so recht motiviert scheint sie auch nicht zu sein. Schon beim zweiten Stopp in Kunszentmiklós-Tass erschnauft sie sich eine Verspätung von vierzehn Minuten. Die Puszta hat schon ihren ganz eigenen Reiz – so formuliert man das höflich, wenn etwas besonders langweilig ist. Der Bahnverkehr im Süden Ungarns scheint noch nie sonderlich ausgeprägt gewesen zu sein, über das Nachbargleis in Fülöpszállás ist längst Gras gewachsen. Die Bahn verkehrt weitgehend eingleisig, die Bahnhöfe dienen als Ausweiche, auf einer internationalen Strecke, die 1878 auf dem Berliner Kongress ausbaldowert wurde und Wien mit Konstantinopel verbinden sollte. Ihre Bedeutung nahm nach dem Bruch Titos mit Stalin im Jahre 1948 rasch ab, Jugoslawien wandte sich zaghaft dem Westen zu. Nun, zwischen Stuttgart und Zürich ist das mit der Eingleisigkeit streckenweise kaum anders, im 21. Jahrhundert. Dafür zähle ich vier Störche und ein Reh.
Was eigentlich für Rumänien gesetzt war durch Bilder aus der Kitschbibliothek, dort aber gar nicht eintraf, begegnet mir jetzt kurz vor Soltzentimre: Einen Pferdewagen mit Heu. Über die Anbindung dürfen die Einheimischen nicht klagen: Milchkannen sind zwar keine zu sehen, dennoch hält der Zug an jeder. Felder, Felder, Felder, die hinten Csengöd von der sog. Ungarischen Steppe abgelöst werden, wo die, wie jedes Kind spätestens seit der sechsten Klasse weiß, die eolischen Flugsande ihr Unwesen treiben. Die Landschaft verflacht zusehends.

Kelebia, Grenzstation. Der Zug leert sich, zumindest der Großraumwagen der ersten Klasse, nach Serbien will außer mir fast keiner. Raus lassen einen die Ungarn gerne, reinkommen dürfte schwierig werden, einen Doppelzaun wie diesen habe ich letztmalig in Arizona gesehen, an der Grenze zu Mexico. Willkommen bei der Железнице Србије. In Subotica – Суботица – auf der serbischen Seite kommt der dunkelblaue Polizist immerhin singend ins Abteil, nimmt meinen Pass entgegen – und diesen mit. Tragbare Lesegeräte kann sich hier niemand leisten. Wäre das ein Deal – Beitritt in die EU nur mit Lesegeräten! Dobre Dan! Aber was zur Hölle machen sie gerade mit meinem Pass? Grenzüberschreitungen sind immer auch künstliche Aufregung. Ein älterer, sehr distinguierter Herr klopft mit seinem Stock an die Scheibe. „Is there anyone else in the train?“ Ja, schreie ich, einen gäbe es noch, ein paar Reihen weiter hinten. Dort pocht es wenig später, aufgelöst wird dieses Rätsel nicht.
Wenig deutet darauf hin, dass wir uns hier in der fünftgrößten Stadt Serbiens befinden, in der die Minderheit der Magyaren die Mehrheit bildet. Wir sind etwa zehn Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Subotica bedeutet „Samstägchen“, Ex-DDRler erinnern sich bestimmt noch an den Begriff „Subbotnik“, der die unbezahlte Schicht am Samstag umschrieb. Heute ist übrigens erst Freitag und ich befinde mich erstmals in meinem Leben in der „Batschka“ und damit einem Teil der Vojvodina, in der auch das Volk der Bunjewatzen lebt, römisch-katholischen Glaubens, die einen ikavisch-štokavischen Dialekt sprechen usw. Und ich hatte lange Mühe, bloß Slowenen, Slowaken und Slavonen auseinander zu halten.
Meinen Pass ziert nun ein Stempel mit kyrillischen Buchstaben, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Einreise in die USA. Die Lettern sind mir seltsam vertraut, früher habe ich in meinem Tagebuch die kyrillische Schrift verwendet, damit es niemand lesen konnte. Ich leider später auch nicht mehr. Die Serbenschaffner kommen im Doppelpack. Der eine wird anscheinend gerade angelernt und weiß noch nicht, wie er die Zange halten soll. Die beiden sind etwa gleich alt, so um die fünfzig, was der Szene etwas sehr Rührendes verleiht. Aber, das darf man nicht vergessen, keiner weiß, was die vor fünfundzwanzig Jahren gemacht haben, junge Männer in Turnschuhen haben damals einen verbissenen, bestialischen Krieg geführt. Der Routinier hat einen Kaffeekocher einfachster Bauart dabei und verfügt über Kenntnisse, wo sich die Steckdose befindet. Gleich gibt es Nescafé für ihn und den Kollegen. Ein Grill würde mich hier wenig wundern. Um die Stimmung unter den beiden Fahrgästen etwas aufzulockern, lässt der Zugchef die neuesten Hits lautstark auf seinem Handy laufen, und zwar ausschließlich französische.
Was Hawaiianer im Überfluss haben, fehlt auf dem Balkan: Vokale. Vielleicht sollte man sich da mal um einen Austausch bemühen, denn auf den pazifischen Inseln sind Konsonanten Mangelware. In Vrbas stehen wir eine halbe Stunde herum, ein Grund dafür ist nicht ersichtlich. Im Waggon wird freies Internet angeboten, aber nicht geliefert. Wenn man vorher die überaus effizienten Ungarn erlebt hat, wird man das Gefühl nicht los, dass den Serben alles ein kleines bisschen egal ist. Vielleicht kein Wunder bei eben dem, was vor fünfzwanzig Jahren passierte. Warten auf den Gegenzug, weiter mit Gezockel. Nach einer weiteren halben Stunde gibt der Lokführer überraschenderweise Gummi. Mal unter uns: Die Serbischen Eisenbahnen sind die uneffektivsten, die mir bisher untergekommen sind. Die malade Lok haben sie in Novi Sad abgekoppelt und durch eine deckungsgleiche ersetzt, offensichtlich mit deckungsgleichen Macken. Es ist Freitagnachmittag, der Bahnsteig ist übersät mit Fahrgästen, und wir kommen mit zwei Zweitklasswaggons an? (Wahrscheinlich wie jeden verdammten Freitag …) Was zur Folge hat, dass sie die 1. Klasse nun freigeben, die sich in Windeseile füllt. Sogar die Plätze der Zugbegleiter werden in Beschlag genommen – da müssen die halt mal was arbeiten. Wir wackeln tapfer weiter durchs Pleistozän. Irgendwann die Donau, ein Häppchen Wald, Weinberge. An einem Brückenneubau müssen wir warten, das ist okay, sie arbeiten noch dran, womöglich sind wir der erste Zug, der das Bauwerk passiert. Die Maschine, die sie vor einer halben Stunde eingewechselt haben, gibt bei Karlovački Vinograd den Geist auf. Sie haben für internationale Ansagen kein englischsprachiges Personal an Bord, was auch wurscht ist mangels Lautsprechern.

Rade Koncar – Zagreb, Yugoslavia steht auf der Lok, das vermittelt einem eine Idee über das Alter der Lok. Sabotage, vielleicht? Egal, ich habe ja keine Anschlüsse zu kriegen, keine Termine, aber da sind bestimmt genug Leute, denen jetzt der Kittel brennt. Hier wird an einer Schnellbahntrasse gewerkelt, von den Chinesen bezahlt, die etwa in 300 Jahren in Betrieb gehen soll. Eigentlich sind wir mit der Lok, die sie vor die kaputte geschnallt haben, ganz gut vorangekommen, aber dann kamen sie auf die krude Idee, beide Loks auf offener Strecke nach hinten zu rangieren, um wieder ein Stück zurückfahren zu können. Oder wohin auch immer. Hoffentlich nicht Richtung Budapest. Mittlerweile sind es achtzig Minuten nach der avisierten Ankunft in Belgrad. Nach Ungarn geht es dann doch nicht, irgendwo sind wir richtig abgebogen, um zweieinhalb Stunden verspätet in Belgrad anzukommen. Noch 1991 brauchte der Zug für die serbische Strecke nur zweieinhalb Stunden, aber da man weder das Gleisbett gemacht noch den Fuhrpark gepflegt hat, liegt man mittlerweile bei vier – an günstigen Tagen. Heute war keiner.
Das ist der amtliche Balkan hier, durchdrungen von einer abenteuerlichen Wurstigkeit. Zur näheren Inaugenscheinnahme Belgrads fehlen mir allerdings zweieinhalb Stunden. Ich beschließe den Abend in einer Burger-Bar gerade um die Ecke vom Hotel, wo sie auch Craft-Beer ausschenken, weshalb sie folgerichtig Burger Craft heißt. Belgrad startet gerade durch, startet up, und vielleicht wirke ich für den Besitzer irgendwie international, weswegen er mich unentwegt nach meiner Meinung fragt, und ich antworte ihm wahrheitsgemäß, dass ich alles gut fände.
So, wie er jetzt da steht, stand er auch schon gestern Abend da, mein Zug, ich bin schließlich lange genug um den Bahnhof herumgeschlichen. Als wäre mir klar gewesen, dass die Tage des altehrwürdigen Ensembles gezählt sind, sechsundfünfzig bleiben ihm noch, um genau zu sein, dann wird der alte Hauptbahnhof Belgrad Glavna verlegt nach Belgrad Centar, irgendwie nach Wiener Vorbild, nur nicht so elegant. Und vor allem nicht so schnell, sie werkeln seit 1977 daran herum, irgendwie analog zum Zugtempo. 1977 – seit der Zeit mache ich Kabarett. Immer wieder kam es zu Baustopps, nicht zuletzt wegen der NATO-Luftangriffe im Jahre 1999. Erst neun Jahre später nahm man die Bauarbeiten wieder auf. Interessant, dass auf den Glavnatafeln BELGRADE steht, auf englisch also, bei gerade mal einem halben Dutzend internationaler Züge täglich. Nach 134 Jahren kommt Glavna zum alten Eisen. Der Bahnhof ist klein, d. h. überschaubar, sehr viel Eisenbahn gibt es nicht in Serbien. Als Ersatz halte ich mich an den alten Basler „Trämli“ schadlos und whatsappe gleich ein Foto an einen Freund in Basel: Schau mal, Belgrad ist ein Gnadenhof für alte Straßenbahnen der BVB. Bei meinem Zug wird soeben die Lok vorgespannt, gleiches Modell wie gestern, man darf gespannt sein. Angeblich soll diese Zugkomposition bis Zürich fahren, mit ausschließlich zweiter Klasse, da hätte ich also schon im Wagen übernachten können.

Die Dame in der Reihe vor mir tippt ihre Lebenserinnerungen ins Handy, klack-klack-klack, ich beginne die kleinen Nervtöter immer mehr zu hassen. Der Waggon ähnelt dem Innenraum eines Greyhound-Busses, ähnlich schmuddelig, ähnlich wenig Fußraum, nur dass im Greyhound keine Uniformierten durch den Mittelgang stapfen, auf deren Rücken in kyrillischen Buchstaben „Полиција“ steht. Die rostrote Brücke über die Donau bietet Anlass – Herweg wie Rückweg – zu einem längeren Stopp über dem Fluss. Zeit für ein letztes Gebet, denn rostrot bedeutet womöglich auch rostzerfressen.
Sid. Stehe kurz vor dem Wiedereintritt in die EU. Ob meine Handy-Netzwerke dann wieder erreichbar sind, die sich in Serbien eine kleine Auszeit gegönnt haben? Die Einheimischen reisen jetzt von einem Land ins nächste, wo früher keine Grenze war, vom Nirgendwo in die Europäische Gemeinschaft, von einer Währung in die nächste bei mutmaßlicher Verdoppelung der Reisezeit. War es das, was sie sich erhofft haben vom Krieg? Diese Deppen. Die Serben sind dran, bei jedem fünften Passagier spricht und buchstabiert der Dunkelblaue die Namen laut in ein backsteingroßes Funkgerät, daher weiß ich jetzt, dass die kühle Blonde drei Reihen vor mir auf den Namen Alexandra Dakovic hört und kroatische Staatsbürgerin ist. Der kroatische Zoll heißt CARINA.
Wenn man Serbien nun irgendwann in die EU lässt und vielleicht sogar in den Schengenraum und schließlich noch den Euro einführt, dann wäre man in etwa soweit wie vor den Bürgerkriegen. Vor Jahren ist mir der Unterschied zwischen Slowenien und Kroatien aufgefallen, die Slowenen haben es verstanden, den Krieg auf sechs Tage zu beschränken, und den Kroaten fehlten einfach Jahre der Entwicklung. Der Unterschied ist marginal im Vergleich zu Serbien und Kroatien. Nach Serbien fließen nicht einmal EU-Gelder. Die Kroaten haben Lesegeräte und kontrollieren im Zug. Kroaten können Eisenbahn, die Serben hecheln zwanzig Jahre hinterher. Die kroatischen Häuser sind viel gepflegter unverputzt als die serbischen. Neben der kroatischen baumelt vor der Grenzstation Tovarik – was möglicherweise Freund oder Bruder heisst – die – ätschebätsche – europäische Fahne. Derart gebündelte Grenzerfahrungen können einen zum glühenden Europäer machen. Im Gegensatz zu Belgrad erscheint Zagreb entspannt, ein großer Park gegenüber des Bahnhofs, in dem sogar Menschen verweilen, und nicht Hunderte von Bussen, die aus allen möglichen Richtungen auf einen zugeschossen kommen. Vielleicht ist das noch ein Klischee: Das Gefühl, sich ständig gegen irgendetwas wappnen zu müssen. Dann wäre da noch die Filiale der Bäckereikette Mlinar im Zagreber Bahnhof (der wie sein Kollege in Belgrad auf den Namen Glavna hört), deren Fahrer sich draußen, keine fünf Meter vom Hauptportal, in einer Ecke erleichtert. Mit dem Lieferwagen hat er auf dem Bürgersteig eh den Zugang zugeparkt. Breitbeinig betritt er jetzt den Bahnhof und fährt sich mit seinen ungewaschenen Händen erst einmal durch die Haare, um dann auf der Theke alles zu befingern und schließlich mit den Kisten herumzuhantieren. Kann mir nicht vorstellen, dass es das zum ersten Mal macht. Manchmal wäre ich gerne wendig und stark genug, solchen Typen die Meinung zu geigen. Aber er sieht aus, als hätte er seine Grundausbildung bei den Ustaschas gemacht. Von exakt dieser Kette jedenfalls stammt das leckere Croissant, das ich zum Glück vorher gekauft habe.
7:41h Dobova – die Kroaten kontrollieren. 7:43h Dobova – die Slowenen kontrollieren. Atemberaubend schnell, im Vergleich. Trotzdem steht man noch ein wenig im Bahnhof herum. Nirgends barrierefreie Zugänge. Ein Waldsterben bei Schlagbäumen wäre begrüßenswert, aber Europa ist leider auf einem anderen Trip. Merkwürdic.