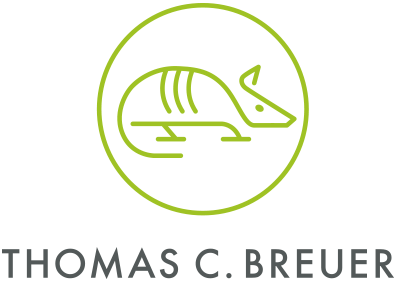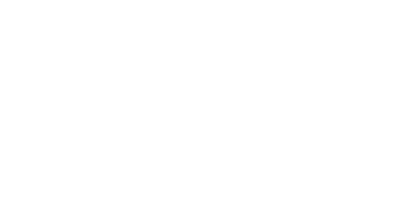Duisburg. Eine Annäherung.
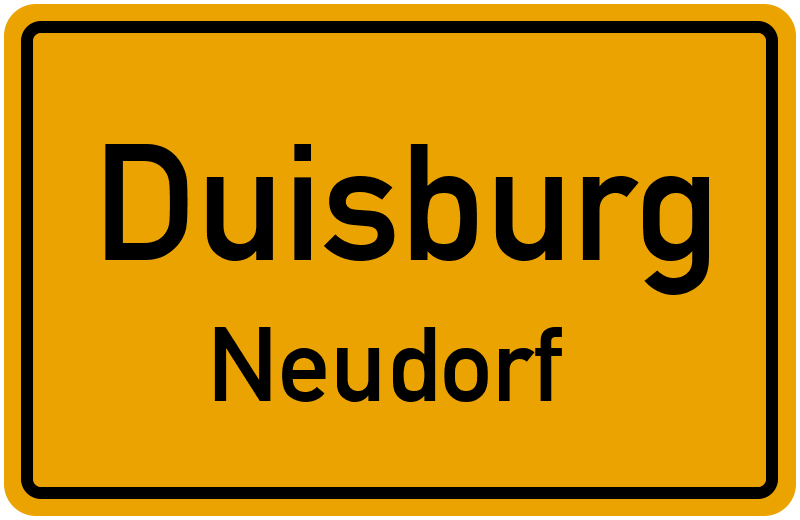
Duisburg. Eine Annäherung.
Eins. Anreise.
Die Anreise ist zeitaufwändig, in der Realität wie im übertragenen Sinn. Für die Fahrt von Koblenz nach Duisburg benötigt man mit dem Auto normalerweise etwas mehr als eineinhalb Stunden. Umgekippter LKW auf der A3 im Westerwald bedeutet diesmal: sieben. Gut, wir haben uns viel zu erzählen, wir waren länger nicht gemeinsam unterwegs, mein Fast Dienstältester Freund (FDF) und ich. Deshalb hatten wir uns zum Altherrenausflug verabredet, und schnell war klar: Madrid oder Mailand, das wird nicht die Frage. Eher diese hier: Wer fährt schon zu einem Wochenendausflug nach Duisburg? Offenbart man jemandem dieses Reiseziel, ist die Reaktion zumindest eine verblüffte und verlangt Erklärung, was wiederum ein Gespräch in Gang setzen kann. Bayern z. B. kann jeder, als Reiseziel, als Fußballclub: Da stößt man auf abhakendes Kopfnicken der Kategorie „Been there. Done That!“ Aber Duisburg? Nun, mein FDF ist Duisburger mit Leib und Seele, aus Großenbaum, das macht die Sache einfach, das Reiseziel geradezu logisch. Wir wollen uns die Stadt ergehen und schauen, wie es uns dabei ergeht. Auch ich verfüge über ein in weiten Teilen verschüttetes Duisburger Erbe, das nach mittlerweile zwei Expeditionen allmählich ans Tageslicht gerät.
Meine erste Übernachtung in Duisburg seit dem ersten August 2007. Die Kopfseite des Zimmers ist mit dem Stadtplan tapeziert, tolle Idee. Da, wo die Kopfleiste des Bettes endet, ist gerade noch die Lenaustraße im Stadtteil Neudorf zu sehen. Der Weg dorthin ist mir geläufig – hinterer Bahnhofsausgang, die Kammerstraße zieht sich, irgendwann links an der Ecke das Haus Nr. 45, in dessen Erdgeschoß meine Tante Ellen fast ihr gesamtes Leben verbracht hat, bis Juli 1967 mit ihrem Vater, also meinem Großvater oder Oppa, wie man in Duisburg sagt. In der Lenaustraße 45 habe ich Anfang 1954 ein paar Tage oder Wochen zugebracht. Meine Eltern hatten mich dort geparkt, weil die Betriebsübernahme des Hotels in Bad Ems ihre ganze Aufmerksamkeit einforderte, vielleicht spielten auch andere Gründe eine Rolle. Natürlich war ich mit dieser Entscheidung nur mäßig einverstanden und versetzte folglich mit meinem Geschrei die Nachbarschaft in Aufruhr, was rasch die spontane Übersiedelung an die Lahn zeitigte. Aber immerhin, womöglich eine frühkindliche Prägung.
Eine weitere Übernachtung war anlässlich der Beisetzung von Omma Gertrud Anfang der Sechziger. Der Sage nach habe ich dabei meinen alten Herrn aus dem Bett getreten, das beherrschte ich anscheinend im Schlaf. So richtig erinnere ich mich nicht, aber dass wir für die Beisetzung den alten BMW V8 vom recht neuen, also zweiten Schwiegervater meines Vaters ausgeliehen haben, weiß ich noch, und ich hoffe, ich habe den – so wie alle anderen Autos jener Zeit – umfassend vollgekotzt, weil dieser Schwiegervater ein alter Nazi war, was ich natürlich erst später einordnen konnte.
Mit dem WDR gastierten wir etwa zwanzig Jahre danach in Rheinhausen, ich erinnere mich dunkel an den Stahlarbeiterstreik mit der Brückenblockade und ein Merkur-Hotel am Bahnhof. Den nächsten Aufenthalt gab es erst weitere zwanzig Jahre später, 2007 eben, und das ist jetzt auch schon wieder sechzehn Jahre her. Eine etwas dürftige Bilanz bei dem Aufkommen an Verwandtschaft: Omma, Oppa, Vater, Tante, dazu die ganze niederrheinische Mischpoke.
Duisburg macht es einem leicht, wirkt offen, zugänglich, gastfreundlich, das ist vielleicht die rheinische Komponente und die Nähe zu den Niederlanden, wo die Leute so sprechen wie Hans Scherpenzeel van Maaskant-Schoutens („Hänschen“) im Schimmi-Tatort. Ausserdem ist das Land bekannt für seinen Eierlikör. DU – die beiden Anfangsbuchstaben kommen vertraulicher daher als beim eher zugeknöpften Siegen. Dabei ist Duisburg ein zwitterhaftes Wesen: Lt. Wikipedia ein Schnittpunkt der Region Niederrhein und dem Ruhrgebiet. Die Stadt gehört dem Landschaftsverband Rheinland an und ist Mitglied des Regionalverbandes Ruhr. Passt eigentlich ganz gut zu jemandem, der nie irgendwo richtig zuhause war, auch im Berufsleben hin- und hergerissen zwischen Kabarett und Literatur, und der jetzt in einer Stadt wohnt, die schwäbisch ist bis auf die Knochen, aber zum badischen Regierungsbezirk Freiburg gehört. Was mir bis zu dieser ersten Reise nicht klar war: Ich bin eh schon herkunftszerrissen, halbproletarisch und halbgroßbürgerlich.
Zwei. Schicksalsort
Deutschlandweit machte Duisburg im Januar 1954 mit der Schlagzeile „Parkographen verhindern Dauerparken“ auf sich aufmerksam, als man die Bürgersteige der Straße „Am Buchenbaum“ mit den ersten Parkuhren der Republik bestückte. Umgehend erhob sich ein lautstarker Proteststurm gegen die sog. „Groschengräber“. Zum Glück für die Stadt gab es damals noch keine sozialen Medien. Es kann gut sein, dass ich das Gezeter noch vernommen habe, aber die exakten zeitlichen Abläufe in unserer Familie kriege ich nicht mehr auf die Kette, da lässt sich nichts konstruieren mit Hilfe von Zeitzeugen. Keine Ahnung, wie ich von Duisburg nach Bad Ems verfrachtet wurde. Ich weiß nicht einmal, ob mein Vater damals ein Auto besaß, Strafzettel aus jener Zeit hat man nie gefunden – aber wenn er eins fuhr, war das ziemlich sicher ein Käfer. Gut möglich, dass sich in Duisburg sogar zwei Prägungen ergeben haben: Oppa bei der Eisenbahn, Vatta Käferfahrer. Später ist mir noch eine dritte aufgefallen.
Die Duisburger haben mich also nur für unbestimmte Zeit aushalten müssen. Jedenfalls nicht lang. Ich vermisste meine Eltern anscheinend so sehr, dass ich kaum zu beruhigen war. Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass ich ja nicht wissen konnte, was das neue Leben für mich bereithalten würde. Sonst hätte ich vielleicht die Klappe gehalten.

Drei. Oppa Willi.
Die Welt kam damals in schwarz-weiß, im „Pott“ freilich mehr schwarz als weiß, selbst an der Schnittstelle von Rhein und Ruhr. Die Schornsteine mussten rauchen in den Jahren des Aufbaus, und das taten sie ausgiebig. Nicht zufällig hatte eine Waschmittelwerbung mit dem verdammten „Grauschleier“ in den Sechzigern einen Riesenerfolg zu verbuchen. Aber Moment: An die Gaslaternen mit ihrem gelblichen Licht erinnere ich mich, und die waren grün.
In Duisburg wurde zwar Kohle gefördert – die Zeche „Westende“ in Meiderich und Laar trug ihren Namen als westlichste des Ruhrgebiets zu Recht, auch in Hamborn wurde abgebaut. Die letzte Duisburger Zeche schloss 2008 in Walsum, aber mehr noch als gefördert wurde Kohle in Duisburg verheizt: In den verschiedenen Stahlhütten. Immerhin eine Gemeinsamkeit mit dem Regierungssitz Düsseldorf, denn damals hieß es: „Im Pott wird das Geld erwirtschaftet, das in Düsseldorf ausgegeben wird.“ Kohle ist ja nicht zufällig ein Synonym für Geld.
Viel davon konnte Willi in seiner Eigenschaft als Bahnschaffner nicht verdient haben, die dunkle, kleine Wohnung in der Lenaustraße war nicht unbedingt Ausdruck eines opulenten Lebensstils. Tochter Ellen, meine Tante, brachte ein wenig Geld in den Haushalt ein, zunächst als Sekretärin, dann als Lehrerin. Die tapfere Ellen musste sich ihren Namen erstreiten, denn ursprünglich war „Petronella“ vorgesehen, wie ein Erfrischungsgetränk aus dem Hause „Rheinperle“.
Viel weiß ich nicht, ich habe Oppa Willi nie wirklich zu Gesicht bekommen, er saß meistens in seinem Sessel und rauchte Zigarre, echte Giftnudeln mit dem Aroma von gehäckselter Socke, und verbreitete munter Nebelschwaden, die wie ein blickdichter Vorhang kaum zu durchdringen waren. In späteren Jahren hätte er gut als Bühneneinnebler ein bisschen was dazu verdienen können, als Gegenpart zum Feuerwehrmann der Städtischen Bühne. Die Erinnerungen sind vage, rare Fotos zeigen einen Mann, der durchaus Modell gestanden haben könnte für einen von Loriots Knollennasenmännern.
Die Zigarre war damals noch nicht Kult, sondern bloß ein Rauchinstrument, ein simpler Stumpen. In jenen Tagen gab es eine Zigarettenmarke namens „Simon Arzt“, für die ein honoriger Weißkittel hinter einem ausladenden Schreibtisch Werbung machte, und in einschlägigen Tabakläden wie dem im Hauptbahnhof konnte man tatsächlich eine Zigarillomarke namens „Sportstudent“ erstehen, die im westfälischen Bünde gefertigt wurde. Das Wort Kult gab es ebenso wenig, die Zeiten waren anders: Tattoos sah man beispielsweise ausschließlich auf den Unterarmen von Seemännern, Fremdenlegionären oder Schiffsschaukelbremsern, meistens Anker, Meerjungfrauen oder Herzen. Stumpen rauchen in Duisburg, das hatte was, als hätte es nicht genug Schlote gegeben, die die Luft verpesteten. Die Rauchentwicklung war beeindruckend, und in den Luftkurorten des Sauerlands oder des Schwarzwalds rieben sich Hotelbesitzer und Sanatorienbetreiber die Hände.
Oppa Willi war Knipser, die Fahrkarten damals von Pappe, auch Bahnsteigkarten waren zu lösen, und bestimmt war er täglich am Hauptbahnhof unterwegs, er hatte es ja nicht weit, die Kammerstraße runter, Hintereingang. Dunkelblaue Uniform, recht zugeknöpft, Schirmmütze, hochseriös, die Bahn war damals noch nicht der lockere Bespassungsbetrieb von heute. Der großmütterliche Teil der Familie stammte vom Niederrhein, ein weitverzweigte Sippschaft namens Hille. Ein Großonkel August betrieb im Hauptbahnhof den Zigarrenladen, was die Finanzlage im Breuerschen Haushalt sicher ein wenig entlastete. Später hockte im Duisburger Stadtparlament ein Ratsherr namens Wilfried Hille, tatsächlich verwandt, der es Anfang 1962 sogar zu einem Artikel in der ZEIT gebracht hatte: Er war am 16.12.1961 aus der SPD ausgeschlossen worden wegen eines Unvereinbarkeitsbeschlusses bezüglich einer Mitgliedschaft in der SPD und im Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS. Wilfried behielt jedoch die Nerven und sein Mandat als fraktionsloser Ratsherr und die SPD verlor ihre absolute Mehrheit – die Genossen mussten ihn jedes Mal anbetteln, wenn sie sein Votum brauchten, was er wohl genossen haben dürfte. Selbst wenn sie sich hier nicht gerade mit Ruhm bekleckerten: Hier kommt die dritte Prägung made in Duisburg: Die Sozen. Christoph Daum, im Alter von sechs nach Duisburg gekommen, soll einmal bemerkt haben: „Man muss nicht immer die absolute Mehrheit hinter sich haben, manchmal reichen auch 51 %.“
Der Duisburger Hauptbahnhof: Ausgerechnet der einzige Ort, wo ich je in den falschen Zug eingestiegen bin, vor lauter Aufregung, weil meine Tochter mit dabei war, etwa drei Jahre alt, wir hatten soeben Tante Ellen besucht, Einkehr im Café Museum inklusive, ich war ungeübt und wollte alles richtig machen und prompt … wir sind gerade noch rechtzeitig rausgekommen. In der Unterführung dieses Bahnhofs habe ich Hanns Dieter Hüsch zum letzten Mal getroffen, der ja keine Viertelstunde von hier auf der anderen Rheinseite aufgewachsen ist, in Moers. Vielleicht ist mir daher der Tonfall so vertraut, denn mit Hüsch hatte ich weitaus mehr zu tun als mit meinem Vater. Besagter Hauptbahnhof ist nicht gerade eine Kathedrale unter den Bahnhöfen, aber dennoch ein würdiger Ort für eine solche Begegnung, haben wir doch die überwiegende Zeit unseres Lebens auf Schiene und Straße verbracht.
An das Breuersche Familienleben in Duisburg habe ich keine so rechte Erinnerung, nicht nur wegen der Zigarren, höchstens an Ellens legendären Nusskuchen. Und den Schokoladenpudding. Als ich aber Jahre später Hüschs Geschichten vom Niederrhein hörte, beschlich mich die Ahnung, dass ich solche oder ähnliche Begebenheiten schon erlebt hatte, Sätze beim Leichenschmaus wie „Jetzt macht mir die ganze Beerdigung keinen Spaß mehr!“ Die Omma starb übrigens 1962, Oppa Willi folgte fünf Jahre später, im Alter von 80 Jahren, soviel zum Thema Gesundheitsschädigungen durch Zigarren.
Dass mein Großvater väterlicherseits Eisenbahner gewesen ist, gefällt mir außerordentlich, da kann ich im Bedarfsfall eine Menge für mich ableiten: Ich habe Eisenbahnerblut in meinen Adern. Wieso ist mir das alles vorher nie aufgefallen? Wieso bin ich über Jahrzehnte hinweg ungerührt in Duisburg umgestiegen? Erst später, als Ellen schon lange tot war, gedachte ich ihrer mit einem warmen Gefühl, denn sie war es, die mir ständig aus der Grütze geholfen hatte, meistens mittels einer Finanzspritze oder aber mit eben jenem Nusskuchen, dessen Duft wie magisch die Mitbewohner meiner WG auf den Plan rief. Da hatte ich dann für mindestens zwei Tage einen guten Stand. Heute denke ich, dass sie als Lehrerin nicht so üppig entlohnt wurde. Sie lebte bescheiden, die Miete war sicher gering, ab und zu eine Reise nach Borkum, oft mit meinem älteren Bruder, selten mal weiter weg: Irland, Schottland, solche Geschichten. So blieb ihr immer noch ein wenig Geld, um mir etwas zuzustecken, wofür ich ihr ewig dankbar bin. Seltsam eigentlich, dass ich dem Duisburger Anteil an meinem Leben nie so recht Beachtung geschenkt habe. Warum? Ich habe da so eine vage Idee.
Vier. Meiderich et al.
Die Zebras natürlich, die unabhängig von Liga und Tabellenstand das Straßenbild beherrschen, als Hoodie, Kappe oder T-Shirt, sogar die Fußgängerüberwege, so witzeln Eingeweihte, hat man nach ihnen benannt. Mein erster Weg in Sachen Fußball allerdings führte mich zu einem Acker mit gelegentlicher Begrünung, dem sog. August-Thyssen-Stadion auf dem Gelände der Thyssenhütte in Bruckhausen, also in Sichtweite derselben, was dazu führte, dass auf den einfach gehaltenen Sitzbänken zentimeterweise schwarzer Staub lag. Der Platzwart entschuldigte sich lakonisch: „Komisch. Hab gestern erst gewischt!“ Es muss allerdings Ecken in Hamborn gegeben haben, wo die Luft rein war. Ich erinnere mich dunkel an eine Patentante, die dort einen Bauernhof betrieben hat, den ich nie zu Gesicht bekommen habe.
Tatsächlich war meinem Vater – Willi II. – das Freundschaftsspiel der Koblenzer TuS Neuendorf gegen die Sportfreunde Hamborn 07 zu verdanken. Bei ersterer war er wohl im Vorstand, und zu den Duisburgern gab es womöglich noch ältere Kontakte. Das Ergebnis weiß ich nicht mehr, es war ja nur das Freundschaftsspiel zwischen zwei Mannschaften, die zum Saisonende 1963/64 beide im hinteren Mittelfeld ihrer jeweiligen Liga dümpelten, die TuS in der Regionalliga Südwest (11.) und die Null-Siebener auf Rang 14 in der Regionalliga West. Drei Jahre zuvor hatten sie es immerhin ins Pokal-Halbfinale geschafft. Der Verein von Christoph Daum, von dem ein weiterer denkwürdiger Satz überliefert ist: „Niemand ist fehlerfrei, das kann, glaube ich, keiner von sich behaupten“. Dazu gesellten sich Günter Preuß und Horst Heese, immerhin. Seltsamerweise nannte man das Team „Löwen“, obwohl ihr Wappen ein Adler ziert. Wahrscheinlich sind wir im weißen Fiat Millecinquecento nach Duisburg gedüst, der meinem Vater einen Hauch von Verwegenheit verlieh, und womöglich habe ich mich übergeben müssen. Heute spielt der Club in der Oberliga Niederrhein und es sieht nicht wirklich gut aus. Immerhin trägt die Spielstätte jetzt einen poetischen Namen: „Containerbau Miro Sportarena im Holtkamp“. Die Anreise im Fiat dauerte keine sieben Stunden, damals gab es noch nicht einmal den Verkehrsfunk. An weitere Reisen mit meinem alten Herrn kann ich mich nicht erinnern.
Mein zweiter Weg führte mich mittenmang ins altwürdige Wedaustadion, allerdings nicht zu einem Spiel des MSV. Am dritten Sonntag im Mai 1984 stand ein Riesenzelt auf dem heiligen Rasen, worin das sog. „UZ-Pressefest“ stattfand, ein Festival mit Musik und Kabarett. Die UZ – Unsere Zeit – ist das Zentralorgan der Deutschen Kommunistischen Partei und war zu dem Zeitpunkt die wohl einzige Zeitung, die mehr Abonnenten als Leser hatte. 1984, das war nicht nur ein orwellschwangeres Jahr, sondern auch die Zeit von Radikalenerlass und Solidarität mit der chilenischen Linken, daher waren Auftritte von Inti Illimani und Mercedes Sosa (in Argentinien wütete ebenfalls eine Junta) gesetzt, bei nahezu jedem Festival, wohlgemerkt.
Meine dritte Begegnung mit dem Duisburger Fußball führte uns nirgendwohin, irgendwie hatte ich den Termin von vorneherein verbaselt oder es hatte eine Spielverlegung gegeben, die ich nicht mitgekriegt hatte (also auch verbaselt …) Mein FDF und ich wollten zum Spiel der Frauenmannschaft des MSV gegen den Freiburger SC, das tatsächlich aber erst einen Tag später stattfinden sollte, nach unserer Abreise. Stattdessen stromerten wir durch die Stadt und mein Fast Dienstältester Freund zeigte mir, wo er zum ersten Mal ein Mädchen geküsst hatte.
Der Fußball hat es nicht leicht, vor kurzem verlor Martina Voss-Tecklenburg ihren Trainerjob beim DFB, und die Zebras des MSV bleiben in der dritten Liga ebenso auf einem Abstiegsplatz wie Hamborn in der Oberliga. Liebe MSV-Fans, es tut mir in der Seele weh, wenn ihr absteigt. Die Quergestreiften sind nicht gerade mein Herzensverein, aber deren Schicksal habe ich stets brav mitverfolgt, nicht zuletzt aus Solidarität mit meinem FDF. Ich werde euch auch in der Regionalliga die Daumen drücken. (Dies festhaltend, könnt ihr es sicher verschmerzen, wenn ich euch beichte, dass ein gepflegtes Köpi gar nicht so meins ist. Kölsch und Alt allerdings auch nicht, muss ich zur Ehrenrettung sagen.) Einen Trost hätte ich anzubieten: Die Regionalliga West erfreut sich immerhin großer Aufmerksamkeit bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Und meinen Herzensverein ist Eintracht Trier, da ist alles noch ärger.
Fünf. Das Kleine.
„Was ich erlebt hab‘, das konnt‘ nur ich erleben / Ich bin ein Vagabund / Selbst für die Fürsten soll’s einen grauen Alltag geben / meine Welt ist bunt. Meine Welt ist bunt.“ Diesen Text von Peter Moesser, nebenbei eine Coverversion von Jim Lowes „Gambler’s Guitar“ von 1957, hat Fred Bertelmann singenderweise bekannt gemacht. Bertelmann war tatsächlich ein Vagabund, stammte aus Meiderich. Eigentlich war ich Zeit meines Lebens nichts anderes, wobei die Welt nicht immer bunt war. Auch für Fürsten nicht.
Meine Auftritte in Duisburg waren nicht unbedingt eine Offenbarung. Ein trister Nachmittag im Rathauskeller Hamborn, dem ehemals größten Dorf Preußens. Es war meistens der Keller, zu ebener Erde ließen sie uns selten auftreten. Ein viertelhundert Besucher, darunter das Tantchen und das Ehepaar Stein, ihre besten Freunde und – Kommunisten, ihr großes Herz ließ da Toleranz zu. Katholizismus und Kommunismus haben durchaus Berührungspunkte, das fängt schon beim Anfangsbuchstaben und den letzten fünf Lettern an. Hamborn war nicht gerade eine Sternstunde abendländischer Kultur an diesem Novembertag im Jahre 1985, aber solide Arbeit. Dann die „Unterhaltung am Wochenende“ (WDR) in Rheinhausen, während des Stahlarbeiterstreiks. Auch hier: solide Arbeit, wenig Glanz.
Am 1. August 2007 war ich für einen Anlass des Berufstrainingszentrums im „Hundertmeister“ gebucht, zu jenem Zeitpunkt der angesagte Laden in Sachen Kabarett. Keine zwei Wochen später hat ein ’Ndrangheta-Killer vor der Pizzeria Bruno sechs Menschen in ihrem Auto erschossen, zwölf Gehminuten vom Auftrittsort entfernt. Schimmi war da zwar noch im Dienst, allerdings nicht für den Tatort. Sollte es einen Zusammenhang geben zwischen meinem Gastspiel und dem Blutbad? Quatsch. Das sollen, wenn sie mögen, die Verschwörungstheoretiker herausfinden. Andererseits: Kabarettist, das ist ein gefährlicher Beruf. Eine Werbekampagne für Duisburg war das Mafia-Event jedenfalls nicht, auch wenn es den Gaffertourismus belebte. Mehr und weit schlimmere Schlagzeilen generierte die Love Parade drei Jahre später, mit 21 Toten und vielen Verletzten und einem bundesweiten Entsetzen, auch wegen des unwürdigen Taktierens des Oberbürgermeisters Sauerland, der die Stadt für lange Zeit in den Nachrichten hielt.
Nicht nur deshalb hatte Duisburg über Jahre einen miserablen Ruf. Eine Zeitlang dachten viele Deutsche, in Vierteln wie Ruhrort oder Marxloh sei es derart schlimm mit der Gewalt, dass sogar Personenschützer Security brauchen. Dennoch muss man keine kugelsicheren Westen anlegen, wenn man die runtergerockten Industrieviertel besuchen möchte, die nebenbei keine übriggebliebenen Kulissen aus alten „Stahlnetz“-Folgen oder Schimanski-Tatorten sind. Mit dem hatten es vor allem die Stadtoberen anfangs gar nicht so: Der trinkfeste Frauenfreund George, für den eigens das Wort „Raubein“ erfunden wurde, kam in der Riege der anderen betulichen Kommissare eher verhaltensauffällig daher. Wie das oft so ist: Heute gibt es zumindest in Ruhrort eine kleine Horst-Schimanski-Gasse.
Mit Schimmi wurden in der Reihe endlich andere Saiten aufgezogen. Er hat eine Art Parka am Sonntagabend zur besten Sendezeit salonfähig gemacht, die Feldjacke M65. Die Morde wurden in derart runtergeranzten Schmuddelecken begangen, dass die Stadtoberen vor allem deshalb besorgt waren über das Image der Stadt. Beim „Kommissar“ wurde gerne im beschaulichen Grünwald gemordet, und das Personal kam ordentlich proper daher, mit Linealscheitel, glattrasiert, Pepitahut. Schimanski hatte man den überkorrekten Thanner an die Seite gestellt, um die Verlotterung Schimanski zu unterstreichen. Ruft man einen alten Schimmi-Tatort in der Mediathek auf, landet man bei Filmen, die lt. WDR-Auskunft als „Bestandteil der Fernsehgeschichte“ gelten, die „in ihrer ursprünglichen Form gezeigt werden“. Das fiktionale Programm enthält „Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.“ Um mit dem Helden zu sprechen: „Red kein Blech!“ Die Filme der frühen Achtziger Jahre präsentierten Terroristenplakate im Büro und Maggiflaschen auf den Kantinentischen, Telefone im Auto und Faxgeräte, obendrein ein Hochamt der Industriebrachen, die womöglich das Interesse von Immobilienheinis auf sich gezogen haben. Der erste Tatort lief 1981, drei Jahre später kam Miami Vice auf den Bildschirm, das absolute Gegenprogramm, auch was das Tempo anging, mit modisch hochgekrempelten Ärmeln und viel Selbstbräuner, wobei es im Großraum Miami hinreichend Schmuddelecken gibt.
Wie kommt Duisburg aus diesem Elend des 21. Jahrhunderts wieder raus? Vielleicht kann Humor helfen, Abstand zu gewinnen, sich zu besinnen, auf Null zu stellen. Wie Fußballspieler gerne sagen: „Mund abwischen. Weitermachen.“ Der Standup-Comedian Markus Krebs aus Neudorf hat das einmal so formuliert: „Wenn du aus Duisburg kommst, hast du vor nichts mehr Angst!“ In Sachen Humor kann Duisburg wenigstens mit Kai Magnus Sting und Abdelkarim aufwarten, eben mit Markus Krebs und Toni Bauer, dem jungen Wilden aus Marxloh mit dem Kurzdarm-Syndrom. Natürlich ist Duisburg auch ein guter Ort, um wegzugehen, so wie Dirk Stermann das getan hat, der es als einziger Piefke in Wien zu Ruhm und Ehre geschafft hat, wofür ihm hoher Respekt gebührt.
Lange Jahre musste ich bei der Anreise mit dem Zug aus südlicher Richtung eine Station vor Duisburg aussteigen. Schon merkwürdig, wie viel Zeit man an Orten verbringt, mit denen einen nicht nur nichts verbindet, die einem im Gegenteil sogar unangenehm auf die Pelle rücken. Natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, aber was will man machen? In Düsseldorf habe ich insgesamt mehr als eineinhalb Monate meines Lebens verbracht, zum Glück nie am Stück. Allein zwischen 2002 und 2016 gastierten wir mit unseren WDR-Shows „Update“ und „Schlag auf Schlag“ dreiunddreißig Mal im Kommödchen in Düsseldorf, etwa dreißig Kilometer vom Duisburger Hauptbahnhof entfernt. Die Anlässe in Duisburg lassen sich an einer Hand abzählen, die Düsseldorfer liegen insgesamt bei annähernd fünfzig. Ich hatte also hinreichend Gelegenheit, Düsseldorf in Augenschein zu nehmen, was der Stadt nicht gut bekommen ist. Geschweige denn mir. Unsere Radioshows waren der einzige Spaß dort, und natürlich der Anmarsch zum Theater, sonntags über die Kö, wo Limousinenbesitzer mit Kennzeichen NE oder ME ihre Autos, Hunde und Frauen präsentierten, in etwa der Reihenfolge. passend zur Atika-Werbung aus den 70er Jahren: „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Tatsächlich wirkte die Szenerie schon Anfang der Nuller Jahre ewig gestrig. Jet-Set auf Verona Pooth-Niveau. Das Beuys-/Kraftwerk-Düsseldorf ließ sich auf der Kö eher nicht blicken. Gelegentlich kam einem der Satz von Mark Twain in den Sinn, der den ultimativen Satz über Baden-Baden geschrieben hat: „Eine Stadt, die bis auf Betrug, den kleinen Schwindel und das Protzentum hohl ist.“ Düsseldorf, das ist Baden-Baden für Arme.
Hier begegneten einem Männer, die Autos fuhren, deren Namen sie höchstens annähernd richtig aussprechen konnten, ähnliches galt für ihre Kinder. Es waren die Frauen, die sich die Nasen an den Auslagen der Geschäfte plattdrücken wollten. Beim Flanieren über die Kö konnte man recht schnell zu dem Schluss gelangen, dass Neid eine völlig überflüssige Charaktereigenschaft ist.
So nah, und doch so fern. Denkwürdig bleibt Düsseldorf für mich wegen meines letzten Spielabbruchs bei einem Gastspiel in einer Weinstube in der 26. Minute, mitten im Satz. Das war der Einzigen im 21. Jahrhundert, und der vollzog sich in einem frisch gentrifizierten Viertel, das auch Christian Lindner beherbergt, ein bisschen Schicki, zum Micki hat es nicht ganz gereicht, und eine absolute Unbespielbarkeit des Platzes. Der Veranstalterin habe ich tags darauf gemailt: „Dass mir das in einer Stadt wie Düsseldorf widerfährt, passt bestens ins Bild. Und Sie passen bestens in diese Stadt. Und wenn ich nur gewusst hätte, dass dieser Widerling Sarrazin bei Ihnen gelesen hat, hätte ich ohnehin vorher abgewunken. Leider kann man aus einigen Hundert Kilometern Entfernung nicht immer wissen, worauf man sich genau einlässt. Das musste ich halt erst auf die harte Tour lernen.“ (Nach vierzig Jahren im Geschäft.) „Ich hoffe, Sie scheitern mit ihrem Projekt, das würde die Welt ein kleines bisschen besser machen.“ Gute Nachricht für mich: Den Laden gibt es nicht mehr. Gute Nachricht für Düsseldorf: Ich bin seither nicht mehr da gewesen, und in Zukunft möchte ich hier höchstens umsteigen.
Sechs. Vatta.
Déformation professionelle: Ein Thema wird angedacht, sofort kommen die Einschläge. Schlimm war es z.B. früher beim Brainstorming für unsere Radioshow Zungenschlag, da polterte es unvermittelt aus mir heraus und die anderen hatten Mühe, mir das Maul zu stopfen. Nimm die Begriffe Vater und Mutter: In Mutterstadt hatte ich eine Lesung. Im Turnen (Leibesübungen) galt ich dem Gauturnlehrer als Muttersöhnchen und wurde dementsprechend gemobbt, auch wenn es den Fachbegriff noch überhaupt nicht gab. Am „Vater“ habe ich mich redlich abgearbeitet, 1981 entstand das Gedicht Vaterland, eine Art Vorläufer des Rap, ein Sprechgesang mit Strophen in unterschiedlichen Dialekten, der mit folgender Zeile seinen Höhepunkt erreichte:
„Es ist immer was los, am laufenden Band /Es gibt wirklich alles im Vaterland. /Ich hab meinen Vater nie gekannt. /Der ist, als ich klein war, durchgebrannt.“
Durchgebrannt ist er nicht, sondern einfach nur in eine andere Stadt gezogen. Schon der Begriff Vaterland ist heikel. „Acht Monate Schnee, zwei Monate Regen, das nennt die Bande Vaterland!“ Hat wer gesagt? Ein gewisser Napoléon. Über uns, übrigens. Anscheinend aber hat mich das Thema weiter umgetrieben, bald erschien das Buch „Hotel Vaterland“, damals habe ich mir nichts dabei gedacht und war dankbar, als mir jemand einen Suppenteller mit der Aufschrift „Hotel Vaterland“ überreichte. Später nannte ich meine Homepage „Heimatseite“, aber heute begibt man sich mit derlei Begriffen in schwere deutschtümelnde See – andererseits darf man sich nicht alles von irgendwelchen Arschlöchern wegnehmen lassen. (Will you please excuse my English.)
Zum Thema Vater gab es also die üblichen Ablenkungsmanöver mit Witzen und Wortspielen, irgendwann landete man beim fast so zwangsläufigen wie unentschuldbaren „Vater morgana“ – bloß um nicht auf sich selbst zurückgeworfen zu werden, sich dem Thema zu stellen: Verlust, Trauer, Alleinsein, was immer da alles aufpoppt.
Lange Zeit haben mein Bruder und ich unserem Vater eine gewisse Omnipräsenz im Zweiten Weltkrieg unterstellt, Italien, Nordafrika, Skandinavien, such dir was aus. Ein Tagebuch meiner Mutter, das ich erst vor wenigen Monaten zu Gesicht bekam, schaffte Klarheit: Bei Tobruk hatte sich mein Vater die Malaria eingefangen, er wurde daher zur Behandlung nach Eisenach in Thüringen geschickt – wo das Hotel meiner Großeltern als Lazarett diente. Dort haben sich die beiden kennengelernt. Das Tagebuch behandelt ausschließlich das Jahr 1945. Meine Mutter ein „Backfisch“ von zwanzig Jahren, schreibt darin schwärmerisch an meinen Vater, der in den Norden versetzt worden war. Die letzte Anschrift: Hadersleben, DK, Oberfähnrichschule 1, 3. Inspektion, Fhj. Uffz. Zu jener Zeit war der Bruder meiner Mutter in Russland verschollen, nur um einmal die Brisanz zu verdeutlichen. Nach dem Krieg gingen mein Vater und meine Mutter nach Schwetzingen, wo sie zum großen Verdruss ihres Vaters heirateten und meine Mutter einen Job bei den Amerikanern im Patrick-Henry-Village annahm.
Ellens Verlobter ist aus dem Krieg nie zurückgekehrt, und meines Wissens hat sie sich nie wieder mit einem Mann eingelassen. Mir ist jedenfalls keiner aufgefallen. Die Wohnung in der Lenaustraße war stockkatholisches Terrain, Ellen in der Gemeindearbeit unterwegs, auch durch ihre Schule, und sie hat ihrem Bruder die Scheidung nie verziehen, obwohl diese ja eher von meiner Mutter forciert worden war. Willi II. war danach in Duisburg nicht wohlgelitten. Meine Mutter war bei der Protestheirat in Schwetzingen protestantisch geblieben, nur um für ihre zweite Ehe zu den Katholen überzulaufen, weil man sie sonst nicht kirchlich getraut hätte. Mich nahm sie leider gleich mit. (Ich habe mich bis heute nicht davon erholt.)
Mein Bruder S. hat mir geschrieben, dass Bruder M. bei ihm angerufen habe, weil er wohl seine Geschichte aufarbeiten wolle. Dazu benötige er Informationen über unseren Vater. Mein Bruder S. kommentierte das so: „In seiner zweiten Familie scheint W.B. noch unbekannter geblieben zu sein als in seiner ersten.“ Ja, eine Ungleichung mit einem Unbekannten. Geradezu nebulös, und dazu brauchte er nicht einmal Zigarrendunst.
Sieben. Destination.
Duisburg war lange nicht präsent in meinem Leben. Warum, habe ich mich Ende des dritten Kapitels gefragt. Weil sich das gloriose, ehrfurchtseinflößende mütterliche Eisenach einfach dominant drübergepfropft hat – drüwwer! Ein Verdrängungsmechanismus. So gesehen hatte ich mir die großmannsche Sichtweise von Opa Albert kritiklos angeeignet, und die Proletarier vom Niederrhein nicht einmal wahrgenommen. Es war viel spannender, das Grand Hotel in Eisenach mit illustren Gästen (Lubitsch, Ringelnatz, um nur die sympathischen zu nennen), mit Weltläufigkeit, Gediegenheit und ähnlichem Schnokus. Der Eisenacher Opa – mit überlangem Oooo – hat auf meinen Vater herabgeblickt, weil der aus kleinen Verhältnissen kam, die er nur zu gut aus eigener Erfahrung kannte, als unehelicher Sohn gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Seiner Tochter wollte er womöglich ein Leben an der Seite eines Mannes, der mit gesellschaftlichen Barrieren und Zurückweisungen zu kämpfen hatte, ersparen. Im besten Fall.

Eisenach wimmelt von eleganten Fabrikantenvillen, von Kultur, von Geschichte – was eine gewisse Dünkelhaftigkeit mit sich bringt. Hier legt man Wert auf gehobene Umgangsformen, jedenfalls im Umfeld meiner Mutter. Auswärtige Menschen kommen zuhauf, trampeln durch die Wartburg, genießen Konzerte, Vorträge, die Natur, Eisenach ist ein beliebtes Reiseziel. Duisburg hingegen, bei allem Respekt, ist trotz Attraktionen wie Hafen, Zoo, Küppersmühle etc. – nicht unbedingt eine Top-Destination, die von Besucherhorden gestürmt wird. Die Vorteile des „Undertourism“ liegen klar auf der Hand: Man stolpert nicht ständig über seinesgleichen. Etwaige Anziehungspunkte sind nicht stumpf- oder blankfotografiert. Weil einen die Menschenmassen nicht durch die Straßen und Gassen schieben, kann man sich sein Auge für die kleinen Dinge bewahren, die sonst gerne übersehen werden. Es bleibt Zeit für das weniger offensichtliche, die Poesie am Rande, die jeder für sich selbst entdecken muss. Ein Name, ein Tier, ein Zettel auf dem Boden, ein goldener Pflasterstein, Pflanzen in Hinterhöfen, Hinterhöfe an sich.
Sowieso wird Schönheit überschätzt. Ich selbst wohne seit Menschengedenken in schönen Städten – Trier, Heidelberg, Rottweil – die müssen sich nicht sonderlich anstrengen, weil ihnen die Herzen ohnehin zufliegen. In Städten wie Duisburg muss man die extra Meile gehen, will man auf sich aufmerksam machen. Mein Geburtsort Eisenach hat alles von Haus aus, Duisburg muss sich Mühe geben. Es wirkt sich nicht unbedingt positiv auf die Dynamik aus, wenn man schon alles hat.
Auf der zweiten Reise mit meiner Frau ein halbes Jahr später hatte ich schon so etwas wie einen Heimvorteil, konnte ihr vieles erzählen und erklären, nicht zuletzt dank der hervorragenden Vorarbeit meines Fast Dienstältesten Freundes. Der erste Trip hat unsere Freundschaft vertieft, leider wurde er durch den Bahnstreik verkürzt, also der Trip. Zwei Besuche in jeweils Duisburg und Eisenach kurz hintereinander haben meine Sichtweise verschoben, die Nebel etwas gelichtet, sogar mein Vater hat an Kontur gewonnen. Die Entdeckung, Erforschung, Besiedlung und Befriedung eines weißen Fleckens auf der persönlichen Landkarte. Die Welt ist wieder etwas weniger novembrig geworden, ein wenig heller, wie Eierlikör etwa. Ich habe das Dellviertel entdeckt mit dem kommunalen Kino – fast ein Grund, sich dort niederzulassen, und den Spielwarenladen von Roskothen auf dem Sonnenwall, usw. Vielleicht also keine Top-Destination, aber Destination bedeutet auch Bestimmungsort, und das englische Wort „destiny“ übersetzt sich mit Schicksal.
Eine Schwäche für das Kleine, Kleingedruckte, Minimalinvasive, Unscheinbare und Übersehene ist jetzt keine Riesenüberraschung bei jemandem, der Jahrzehnte lang mit dem unterwegs war, was man eher geringschätzig als Kleinkunst abtut. Das Versteckte muss man suchen – und finden. Duisburg hat sicher noch eine Menge Kleinode, die es den Besuchern vorenthalten möchte, aber da haben sie die Rechnung ohne mich gemacht. Da liegt sicher auch noch das eine oder andere Familiengeheimnis. Ich bin gespannt auf die nächste Reise.
März 2024